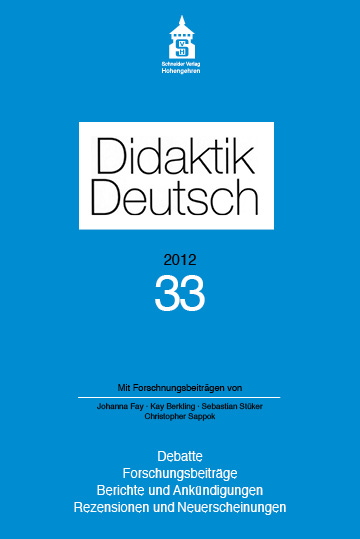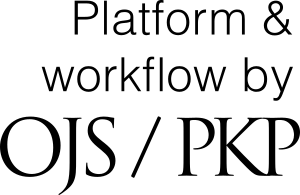Wann wird eine Kommaposition als solche wahrgenommen?
Eine Untersuchung in Jgst. 6 mit einem zu kommatierenden Fremdtext
Abstract
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Frage, wann ein Komma ‚leicht‘ und wann ein Komma ‚schwer‘ ist bzw. was den Schwierigkeitsgrad einer zu kommatierenden Position ausmacht. Hierzu wird ein Modell in der Tradition der psycholinguistischen Sprachproduktionsforschung vorgestellt sowie ein Schritt zu dessen empirischer Evaluation. Dies geschieht über eine Untersuchung in Jahrgangsstufe 6, Gymnasium (n = 167), bei der die SuS einen Fremdtext (12 Sätze) zu kommatieren hatten. Die Analyse gibt Aufschluss darüber, welche Faktoren relevant sind, wenn eine obligatorische Kommaposition als solche wahrgenommen, also ‚bedient‘ wird oder nicht. Innovativ ist dabei die Einbeziehung quantitativer Faktoren. Ein solcher Faktor ist z.B. die Länge der ungegliederten Sequenz vor der aktuellen Kommaposition. Dass Quantität bei naiver Kommasetzung eine bedeutende Rolle spielt, ist eine der Prädiktionen des genannten Modells. Die Ergebnisse zeigen, dass quantitative Faktoren die Fehleranfälligkeit von Kommapositionen stark beeinflussen. Dieser Befund wird in Hinblick auf didaktische Konsequenzen diskutiert.Downloads
Veröffentlicht
2022-10-20
Zitationsvorschlag
Sappok, C. (2022). Wann wird eine Kommaposition als solche wahrgenommen? Eine Untersuchung in Jgst. 6 mit einem zu kommatierenden Fremdtext. Didaktik Deutsch, (33). Abgerufen von https://didaktik-deutsch.de/index.php/dideu/article/view/417
Ausgabe
Rubrik
Forschungsbeiträge
Lizenz
Copyright (c) 2022 Christopher Sappok

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International.